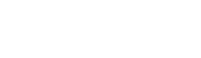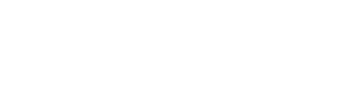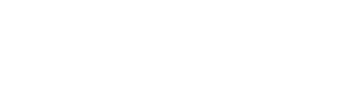Auf dem Darß
Wir sind im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft in der Region Fischland-Darß-Zingst im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das ist selbst den Einheimischen zu viel Zungenbrecherei. Deshalb fahren sie einfach auf den Darß.
Der Nationalpark liegt an der Ostseeküste und erstreckt sich von der Halbinsel Darß-Zingst über die Insel Hiddensee bis zur Westküste Rügens. Mit einer Fläche von rund 790 km² ist er einer der größten in Deutschland.
Diese einmalige Naturlandschaft verdanken wir dem Visionär Michael Succow. Trotz vieler Hindernisse engagierte er sich in der ehemaligen DDR für den Natur- und Umweltschutz. Ab Januar 1990 initiierte er gemeinsam mit seinen Weggefährt*innen binnen weniger Monate ein Nationalparkprogramm, in dem 12 Prozent des DDR-Territoriums als Großschutzgebiete ausgewiesen wurden. Bis zur Wiedervereinigung gelang es, davon fast die Hälfte als Biosphärenreservate, Nationalparke und Naturparke zu erhalten.
Naturschutz und Tourismus
Auf dem Darß stellt sich allerdings die Frage, wie sich ein derart riesiges Naturschutzgebiet mit einer touristischen Region und ihren Ostseebädern wie Wustrow, Ahrenshoop, Prerow oder Zingst verträgt. „Der Nationalpark ist keine geschlossene Fläche, die Orte sind ausgenommen,“ erzählt Linda Sturm vom Nationalparkamt Vorpommern. Und wenn der nächtliche Spaziergang durch Prerow vom Röhren brunftiger Hirsche aus dem angrenzenden Wald begleitet wird, weißt du, dass die Natur hier ganz nahe ist.
Nächsten Tag treffen wir Nationalpark-Ranger Andreas Zahn am Wanderparkplatz „Drei Eichen“ in Born am Darß. Bei seinem Outfit müssen wir nicht lange suchen. Das ist der Mann, der uns in den Nationalpark führen wird und dem wir in den kommenden zwei Stunden Löcher in den Bauch fragen werden.
Auf einem breiten Wanderweg, der auch gerne von Radfahrer*innen genutzt wird, führt uns der Ranger in einen Kiefernwald. Hier schaut es eher aus wie in einem städtischen Erholungsgebiet mit forstwirtschaftlicher Monokultur und nicht wie in einem Urwald. „Ursprünglich waren die Wälder der Region artenreicher,“ erzählt Andreas. „Hier gab es vor allem Buchen, aber auch andere Laubbäume wie Eichen, Erlen und Eschen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden große Flächen abgeholzt, für den Schiffbau oder als Brennholz, und danach mit schnellwachsenden und wenig anspruchsvollen Kiefern wieder aufgeforstet.“
Die stille Verwandlung
Seit 2017 wird hier keine Forstwirtschaft mehr betrieben. Nur die Wege werden gesichert und gesäubert. Die Kiefernwälder entwickeln sich jetzt selbstständig in Richtung eines natürlichen Mischwaldes. Ein klein wenig hat man den Waldumbau nach der Gründung des Nationalparkes unterstützt, indem vereinzelt Buchen gepflanzt wurden. Manche Regionen, in denen ehemalige Moore trockengelegt wurden, werden wieder vernässt. Hier soll sich ein Moorwald aus Birken oder Erlen entwickeln können.
Die Verwandlung ist auch schon zu sehen. Dort, wo noch die Kiefern dominieren, kommt das Licht der Sonne auf den Boden. Hier wachsen meterhohe Farne. Den Ranger freut’s, weil die Besucher bei diesem Dickicht am Weg bleiben. Dort, wo sich mehr und mehr die Laubbäume durchsetzen, kommt nur mehr wenig Licht bis zum Boden. Hier wachsen auch nur wenige und kleinere Pflanzen am Boden.
Ein Stück weiter zeigt uns Andreas Kiefern, bei denen der Stamm eingeritzt wurde. Die V-förmigen Einschnitte, die mich an einen kunstvoll verzierten Marterpfahl aus einem Winnetou-Film erinnern, sind stumme Zeugen eines wichtigen Wirtschaftszweiges früherer Jahrhunderte. Bis zur Wende 1990 hat man hier Harz zur Herstellung von Terpentin, Firnissen und Lacken gewonnen, was wiederum in der Industrie und für die Schifffahrt gebraucht wurde. Mit den synthetischen Ersatzstoffen verlor das Naturharz an Bedeutung, die Gewinnung war nicht mehr wirtschaftlich.
Was ist eigentlich ein Bodden?
Wir sind jetzt mit unserem Ranger schon einige Zeit durch den Wald gelaufen, da drängt sich die Frage auf, was eigentlich ein Bodden ist – der Nationalpark heißt schließlich „Boddenlandschaft“. Andreas holt eine Folie aus seiner Tasche.
„Wenn ihr auf dieser Landkarte schaut, seht ihr, dass wir uns hier auf einem, zum Teil sehr schmalen Landstreifen bewegen. Im Westen und im Norden ist das Meer, auf der anderen Seite sind lagunenartige Buchten, die weitgehend von der Ostsee abgetrennt sind. Früher gab es immer wieder schmale Meeresarme oder Durchbrüche, heute gibt es nur noch bei Pramort am östlichsten Zipfel der Halbinsel eine Verbindung zur Ostsee.“
Das Wasser im Bodden ist nicht ganz so salzig, wie in der Ostsee, sondern ein Gemisch aus Salz- und Süßwasser, je nachdem wo der nächste Zufluss von Meer ist. Die Mischung aus Land, Wasser und Feuchtgebieten macht Boddengewässer zu wertvollen Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten. Durch die Abschirmung von der offenen See ist das Wasser viel ruhiger und so fühlen sich hier auch die Menschen wohl. Zumindest haben sie ihre Häfen im Bodden angelegt.
Der Name Bodden kommt übrigens daher, dass diese Küstengewässer nur ein bis zwei Meter tief sind und man hier den Boden sehen kann. Könnte! „Durch die intensive Landwirtschaft im Süden des Boddens und die Abwässer der Menschen gelangen immer noch zu viele Nährstoffe ins Wasser,“ bedauert Andreas. „Dadurch wachsen die Algen zu schnell und die Sicht im Wasser wird trüb. Seit der Gründung des Nationalparkes ist das aber schon besser geworden.
Weststrand
Wir sind mit unserem Ranger immer noch im Darßer Wald unterwegs, als sich die Bäume langsam lichten und vor uns das Meer samt malerisch weißem Sandstrand auftaucht. Auf neun Kilometer ist der Weststrand Teil des Nationalparks. „Man darf hier am Strand liegen und baden, sollte aber auf keinen Fall die Wege verlassen und schon gar nicht die Dünen betreten“, mahnt Andreas.
Dünen sind extrem empfindlich. Sie bestehen hauptsächlich aus lockerem Sand und die Pflanzen, die dort wachsen, halten das ganze zusammen. Läuft man darauf herum, wird der Sand wieder locker und vom Wind abgetragen. Die Dünen verlieren ihre Schutzfunktion gegen Stürme und hohe Wellen. Darüber hinaus leben hier seltene Tier- und Pflanzenarten, die durch das Betreten gestört oder vertrieben werden.
Auch ohne menschliches Zutun ist die Küste ständig in Bewegung. „Hier geht pro Jahr ein Meter Küste verloren. Der Sand wird im Nordosten wieder angeschwemmt und bildet dort ganz neue Uferlandschaften. Dieser Teil ist Kernzone des Nationalparks, damit streng geschützt. Hier dürfen nur die ausgewiesenen Wege betreten werden, wie etwa der Holzbohlenweg zum Leuchtturm Darßer Ort. Der Rest ist tabu“, setzt Andreas Zahn wieder einen strengen Blick auf.
Der Zug der Kraniche
Nach dieser spannenden Rundwanderung im Darßer Wald fahren wir zum NABU-Erlebniszentrum KRANICHWELTEN nach Günz. Es ist dies Europas größtes Kranichzentrum. Die knapp 50 Kilometer lange Strecke führt durch die Boddenlandschaft. Wir sind mit Günter Nowald verabredet, er ist Geschäftsführer der gemeinnützig anerkannten Kranichschutz Deutschland GmbH und leitet das Erlebniszentrum. In der Ausstellung erfährst du alles über Kraniche auf der ganzen Welt: Dass es 15 Arten gibt, wo sie brüten, wo sie überwintern, welche von ihnen über ganze Kontinente ziehen und die Routen, die sie dafür nutzen.
„Menschen und Kranichen stehen seit jeher in einer engen Beziehung,“ erzählt Günter. „Früher mochten die Menschen Kraniche im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich als Nahrungsmittel. Sie wurden zu ägyptischen Zeiten auch schon als Sonnenvögel gehalten und sie galten als Glücksvögel, weil Männchen und Weibchen ein Leben lang zusammenbleiben. Viele Adelsfamilien hier in Deutschland und in England hatten den Kranich im Wappen. Er gilt zudem als sehr wachsam. Noch vor 300 Jahren hat man ihn als Wachtier gehalten, weil er wachsamer ist als der Hofhund oder Hofgänse.“
Hier in Europa ist der Graukranich beheimatet, und der ist ein Langstreckenflieger. Den Sommer über verbringt er in Skandinavien, im Herbst zieht er quer über den Kontinent bis nach Südspanien. „Dabei fliegen die Vögel bis zu 500 Kilometer am Tag, manches Mal sogar noch mehr“, weiß Günter durch die Auswertung von GPS-Daten. Auf dieser langen Reise müssen sich die Vögel auch einmal länger ausruhen und ordentlich anfuttern. Die flachen Boddengewässer sind ein sicherer Ort, um auszuschlafen.
Die Symbiose von Mensch und Tier wird auch hier deutlich: „Früher, als die Erntemaschinen noch nicht so perfekt funktionierten, blieb von der Ernte genügend Mais auf den Feldern liegen. Heute ist es nur noch weniger als ein Prozent", erzählt Günter. Das ist viel zu wenig für bis zu 70.000 hungrige Vögel. Als Alternative haben sich die Kraniche über das frische Saatgut auf den Feldern hergemacht. Durch das Füttern der Vögel konnte der Konflikt zwischen Bauern und Kranichen entschärft werden.
„Wir haben dieses Jahr 28 Tonnen Mais gekauft und auf dem Feld verstreut. Erst gestern wieder 6 Tonnen. Gleichzeitig haben wir ein attraktives touristisches Angebot geschaffen“, freut sich Günter. Denn praktischerweise liegt die Futterstelle der Vögel gleich neben der Beobachtubgsstation KRANORAMA. Die Gäste haben die Vögel perfekt vor der Linse oder können sie mit Fernrohren beobachten. Die Tiere werden nicht gestört. Wenn das Flugwetter passt, ziehen sie weiter.
Dieses Schauspiel kannst du im September und Oktober erleben, oft kommen schon Mitte August die ersten Vögel. Und auch im März, wenn es in die andere Richtung geht. „Im Frühjahr bleiben die einzelnen Vögel nicht lange, meist nur wenige Tage. Dann ziehen sie weiter, um ihr Revier im Norden zu besetzen. In dieser Zeit kannst du allerdings den berühmten Tanz der Kraniche bewundern, der zu Paarbindung und zur Einstimmung auf die bevorstehende Brut dient,“ schwärmt Günter Nowald über seine Schützlinge.
Anreise & Mobilität
Mit dem Nachtzug nach Berlin und weiter mit dem Zug nach Rostock oder Stralsund. Dann mit dem Bus auf den Darß. Wir haben ab Rostock ein Auto gemietet. Mietzentrale gleich gegenüber Bahnhof. Auf dem Darß ist das Verkehrsmittel der Wahl das Fahrrad. Auf den Dämmen verlaufen die Radwege, Räder kannst du dir überall günstig auszuleihen.
Autor*innen: Christian Brandstätter, Roswitha Reisinger
Zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft>>>
Zum NABU-Erlebniszentrum KRANICHWELTEN>>>
Folge lebensart-reisen auf instagram>>>
zuletzt geändert am 17.10.2025